Palermo ist für viele ein Ort der Farben rosanero, der Düfte und der Geschichten. Wer an die Stadt denkt, hat vielleicht das Bild der Kuppeln und Kioske vor Augen, die Geräuschkulisse der lebendigen Märkte oder die leuchtenden Farben des Meeres. Doch was viele nicht wissen: Palermo ist auch ein Tor zu den Sternen.
Die abendlichen Spaziergänge mit meiner Hündin Donna sind für mich ein tägliches Ritual. Während sie mit feiner Nase ihre Spuren im Gras verfolgt, schaue ich ab und an nach oben. Denn seit einigen Wochen scheint es, als ob der Himmel sich bemüht, mir bei jedem Schritt ein Schauspiel zu bieten. Kaum ist die Sonne versunken, breitet sich über uns ein Sternenteppich aus, so klar und scharf gezeichnet, dass man beinahe meint, die Milchstraße mit der Hand berühren zu können. Und da kommt mein kleiner Helfer ins Spiel: meine Sternen-App.
Ich halte das Smartphone gen Himmel, scanne die Sterne und warte, was der Bildschirm mir preisgibt. Meist tauchen Namen auf, die jeder schon einmal aus dem Horoskop gehört hat. Doch neulich, wie aus dem Nichts, blinkte da ein besonderer Name auf: Ceres.

Ich blieb stehen. Bei mir meldete sich sofort eine Kindheitserinnerung. Ceres war für mich der Inbegriff einer italienischen Werbung. Als Kind fand ich diesen Spot für eine dänische Biermarke irgendwie lustig und unterhaltsam. Und da stand nun derselbe Name mitten am Firmament, zwischen tausend anderen Lichtpunkten. Ich musste sofort nachforschen.
Also begann ich zu lesen: Ceres, kein Stern, sondern ein Zwergplanet im Asteroidengürtel, eine uralte Reisende zwischen Mars und Jupiter. Ein Himmelskörper, der seit Jahrmilliarden seinen stillen Weg zieht und in Palermo entdeckt wurde.
Moment mal – habe ich da gerade Palermo gelesen? Es kam mir vor, als hätte das Universum mich absichtlich dorthin geführt, zu diesem Namen, zu dieser Verbindung von Kindheitserinnerung und kosmischem Geheimnis. Ich beschloss sofort, einen Artikel darüber zu schreiben.
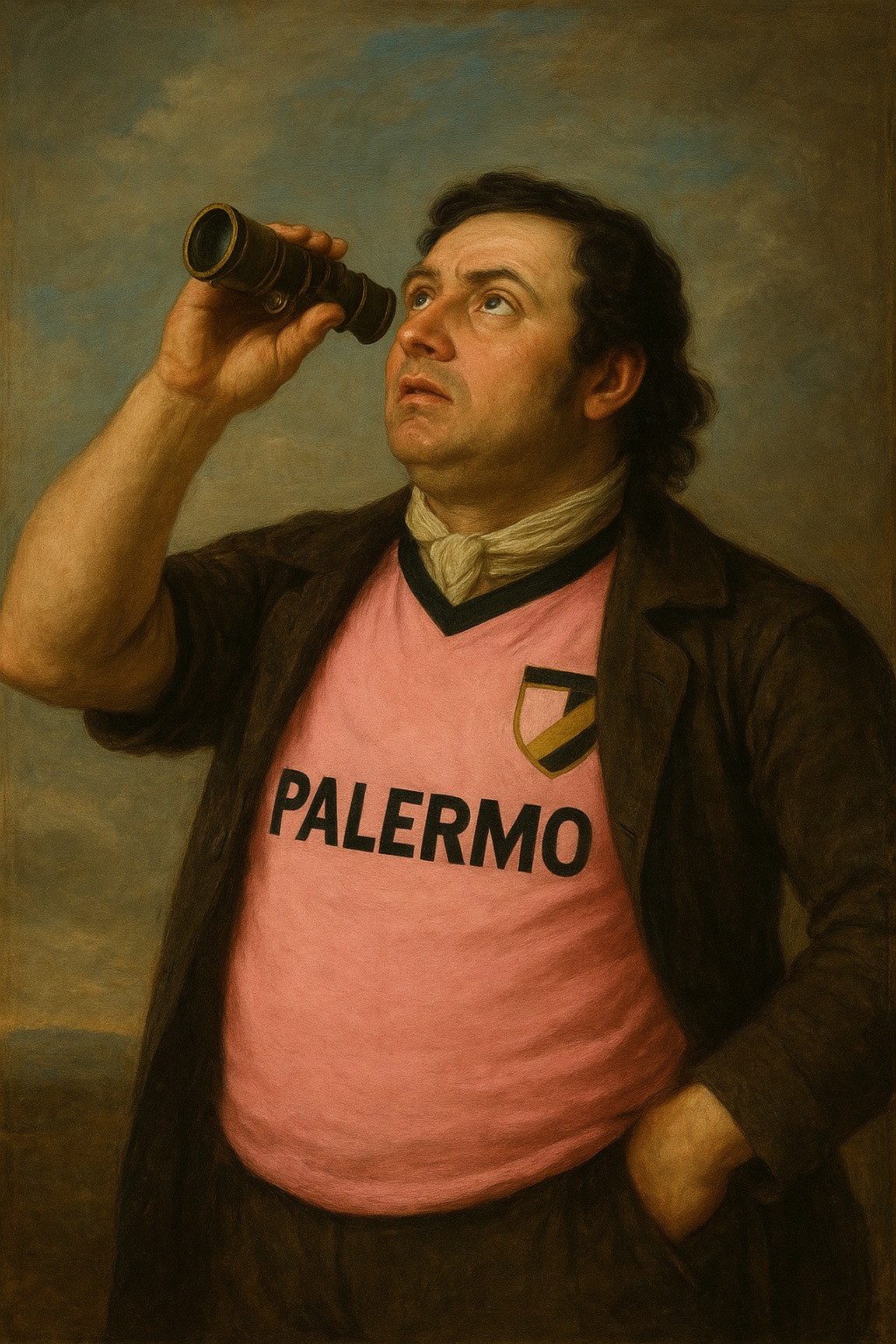
Giuseppe Piazzi im Palazzo dei Normanni
Mitten in der Stadt, im Palazzo dei Normanni, erhebt sich nicht nur ein architektonisches Denkmal der Macht und Kultur, sondern auch eine Wiege moderner Astronomie. Hier gründete Ende des 18. Jahrhunderts der Theologe, Astronom und Universalgelehrte Giuseppe Piazzi das Observatorium, das bis heute aktiv ist. Von diesem Ort aus richtete er seine Instrumente gen Himmel und machte eine der bedeutendsten Entdeckungen der Astronomiegeschichte: Ceres, der erste bekannte Planetoid. Dieser Moment, in der Nacht vom 1. Januar 1801, war der Beginn einer neuen Ära in der Erforschung unseres Sonnensystems.
Giuseppe Piazzi wurde 1746, im norditalienischen Ponte in Valtellina, geboren. Schon früh zeigte er eine außergewöhnliche Begabung für Mathematik und Philosophie, gleichzeitig trat er in den Orden der Theatiner ein. Seine Laufbahn führte ihn zunächst nach Turin, Rom und Paris, wo er sich intensiv mit Mathematik und Astronomie beschäftigte. 1787 folgte er einem Ruf nach Sizilien und übernahm einen Lehrstuhl für höhere Mathematik in Palermo. Doch Piazzi war nicht allein Mathematiker – er war von den Sternen fasziniert. Mit Unterstützung des Vizekönigs von Sizilien begann er, ein modernes Observatorium einzurichten, das schließlich 1790 im Palazzo dei Normanni eröffnet wurde.
Dort, hoch oben im Specola-Turm, installierte er die modernsten Instrumente seiner Zeit, darunter ein präzises Teleskop aus London. Mit diesen Werkzeugen begann er systematisch, den Sternenhimmel zu kartieren – und schrieb damit Geschichte.
In jener Neujahrsnacht beobachtete Piazzi eigentlich Sterne für seinen geplanten Sternkatalog. Doch ein Lichtpunkt, den er zunächst für einen fixen Stern hielt, bewegte sich Nacht für Nacht leicht gegen den Hintergrund der Sterne. Piazzi notierte akribisch seine Beobachtungen und kam bald zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Stern handeln konnte. Er hatte ein neues Himmelsobjekt entdeckt.
Piazzi selbst war vorsichtig. Er schrieb in einem Brief an einen Kollegen, er habe „einen Stern gefunden, der sich bewegt“. Doch schon bald war klar: Dies war die Entdeckung eines neuen Himmelskörpers, zwischen Mars und Jupiter – jenem Raum, den Astronomen seit Längerem im Verdacht hatten, einen „fehlenden Planeten“ zu beherbergen.
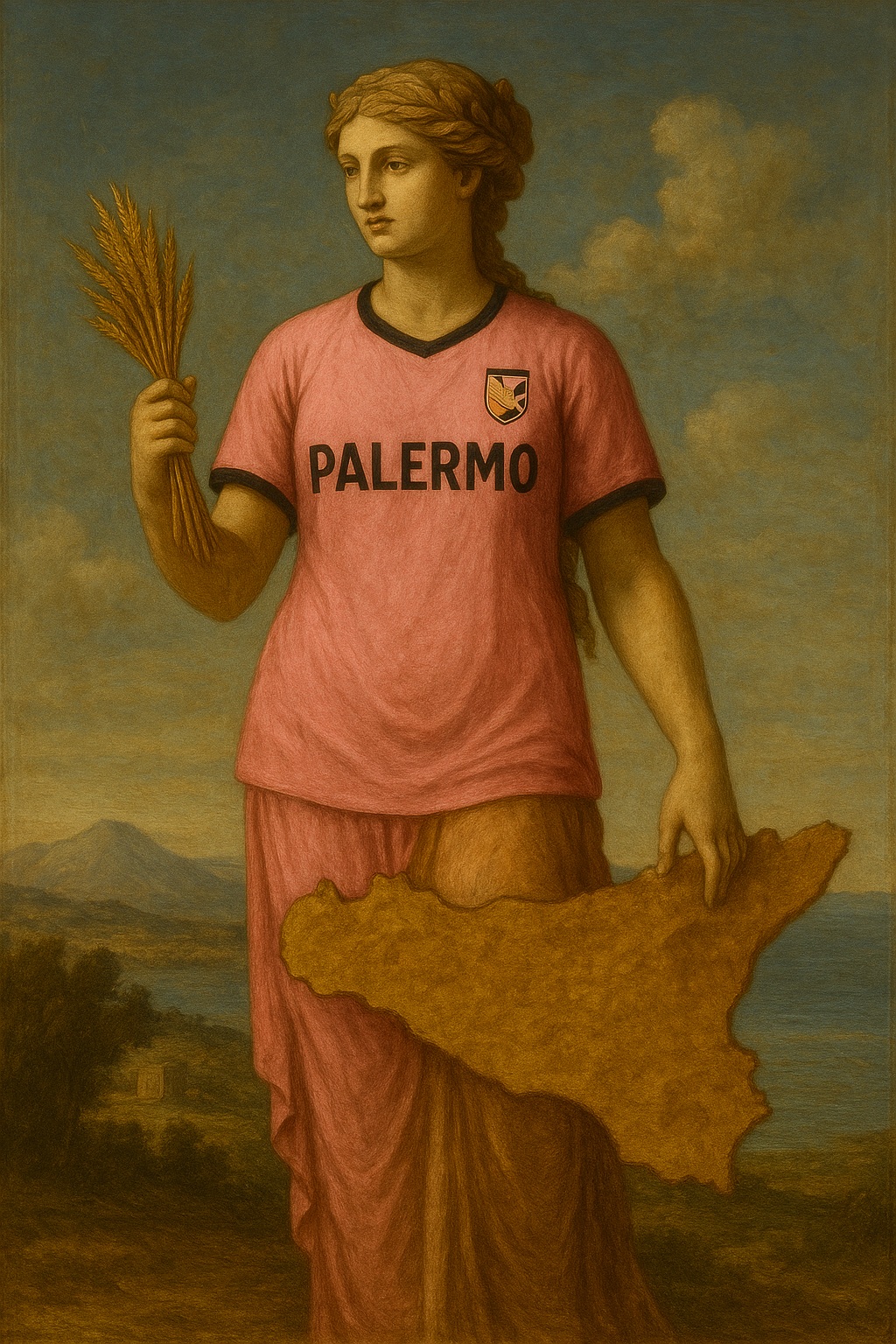
Piazzi nannte den Fund Ceres Ferdinandea – Ceres nach der römischen Göttin der Fruchtbarkeit, die besonders mit Sizilien verbunden war, und Ferdinandea zu Ehren des Königs Ferdinand von Sizilien. Letzterer Namenszusatz setzte sich international nicht durch, aber Ceres blieb.
Dass gerade in Palermo diese Entdeckung gemacht wurde, ist mehr als eine Anekdote. Die Stadt war zu dieser Zeit ein Schmelztiegel wissenschaftlicher Neugier und kultureller Offenheit. Sizilien hatte durch seine Lage im Mittelmeer stets eine besondere Rolle als Brücke zwischen Kulturen gespielt. Nun wurde es auch zur Brücke in den Kosmos.
Der Palazzo dei Normanni, in dem Piazzi arbeitete, war Jahrhunderte zuvor von den Normannen errichtet und von arabischen wie byzantinischen Einflüssen geprägt worden. Er war Machtzentrum, königliche Residenz und kultureller Knotenpunkt. Dass hier ein Observatorium eingerichtet wurde, war ein Zeichen für den Willen, Wissenschaft und Fortschritt in das Herz der Stadt zu holen.

Gauß und die Bahn von Ceres
Doch Piazzis Entdeckung stand zunächst auf der Kippe. Schon wenige Wochen nach der Entdeckung erkrankte er schwer und konnte die Beobachtungen nicht mehr fortsetzen. Ceres verschwand aus dem Blickfeld der Astronomen und man fürchtete, den Himmelskörper nie wiederzufinden.
Hier tritt eine der größten Gestalten der deutschen Wissenschaft auf den Plan: Carl Friedrich Gauß. Der Fürst der Mathematik höchstpersönlich. Der junge Mathematiker aus Braunschweig, damals erst Mitte zwanzig, entwickelte neue Methoden zur Berechnung von Bahnen aus wenigen Beobachtungsdaten. Mit seinen revolutionären Ideen gelang es ihm, die Position von Ceres mit erstaunlicher Genauigkeit vorherzusagen. Als ein weiterer deutscher Astronom, Franz Xaver von Zach, im Dezember 1801 die Ceres wiederfand, bestätigte sich Gauß’ Rechnung eindrucksvoll. Dies war nicht nur die Rettung der Entdeckung von Piazzi, sondern auch der Beginn einer engen Verbindung zwischen Astronomie und moderner Mathematik.

Die Bedeutung von Ceres
Mit Ceres begann die Geschichte der Asteroidenforschung. Anfangs glaubte man, es handle sich tatsächlich um den „fehlenden Planeten“ zwischen Mars und Jupiter. Doch bald darauf wurden weitere Objekte entdeckt – Pallas, Juno, Vesta – und die Idee eines ganzen Asteroiden-Gürtels nahm Gestalt an.
Heute wissen wir, dass Ceres der größte Körper im Asteroidengürtel ist und sogar den Status eines Zwergplaneten trägt – ähnlich wie Pluto. 2015 wurde er von der NASA-Sonde Dawn besucht, die spektakuläre Aufnahmen seiner Kraterlandschaften und geheimnisvollen hellen Flecken zur Erde sandte.
Das Observatorium im Palazzo dei Normanni ist auch heute noch aktiv und gehört zum Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Es forscht in Bereichen wie:
- Sonnenphysik und Röntgenastronomie,
- Sternentstehung und Supernova-Überreste,
- Simulation astrophysikalischer Systeme.
Besucher können zudem das Museo della Specola besichtigen, in dem historische Instrumente aus Piazzis Zeit ausgestellt sind: Teleskope, Sextanten, und der berühmte Ramsden-Kreis, mit dem Piazzi seine Beobachtungen machte.
Die Geschichte von Ceres zeigt, wie eng Palermo mit Deutschland verbunden ist. Ohne Gauß’ brillante Mathematik wäre Ceres womöglich verloren gegangen. Auch der Astronom Franz Xaver von Zach, der damals in Gotha wirkte, spielte eine zentrale Rolle bei der Wiederentdeckung. Damit verschränken sich zwei Welten: Palermo als Ort der Beobachtung, Deutschland als Ort der Berechnung. Gemeinsam schufen sie ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit, wie sie für die Astronomie typisch ist. Eine Wissenschaft, die Grenzen überwindet.
Vielleicht gibt es keine Zufälle. Vielleicht wollte mir das Universum in dieser klaren Nacht sagen: Das wird der nächste Artikel über Palermo für unseren deutschen Blog!
Forza Palermo.



